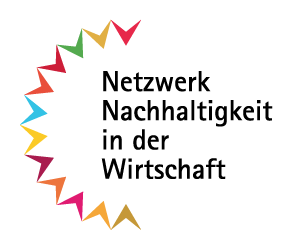Zwei der prägendsten Themen unserer Zeit – Digitalisierung und Nachhaltigkeit – erscheinen auf den ersten Blick wie Gegensätze: Während Digitalisierung mit Innovation, Geschwindigkeit und Vernetzung assoziiert wird, steht Nachhaltigkeit für Bedachtheit, Langfristigkeit und Ressourcenschonung. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass gerade die intelligente Nutzung digitaler Technologien entscheidend dazu beitragen kann, eine nachhaltigere Welt zu gestalten.
Vor diesem Hintergrund fand am 23. Januar 2015 das 10. Treffen des Netzwerks „Nachhaltigkeit in der Wirtschaft“ unter dem Motto „Nachhaltigkeit durch Digitalisierung“ im Diakoniewerk Halle statt.
Begrüßung: Gemeinsam mehr erreichen
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die Netzwerksprecherin, Dr. Sophie Kühling, die in ihrer Begrüßung die kontinuierliche Entwicklung des Netzwerks hervorhob: Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat es über 80 engagierte Unternehmen, Organisationen und Institutionen als Partner gewonnen, um gemeinsam nachhaltige(re) Wirtschafts- und Arbeitsweisen in Mitteldeutschland zu fördern. Zudem bedankte sich Dr. Kühling bei Sven Sommer, der als Teil des Netzwerk-Kernteams die Organisation des Tages federführend übernommen hatte. Mit einem kurzen Überblick über die Agenda stimmte Hr. Sommer die Teilnehmer auf das abwechslungsreiche Programm ein, welches sie an diesem Nachmittag erwarten würde.
Input 1: „Künstliche Intelligenz – Vom Hype zur sicheren Anwendung in der Praxis“
Christian Strebe, Teamleiter Business Development and Innovation beim Halleschen IT-Dienstleister GISA, startete mit einem facettenreichen Vortrag über Künstliche Intelligenz (KI). Er verdeutlichte, dass KI kein kurzlebiges Trendthema ist, sondern vielmehr ein Werkzeug mit großem Potenzial, mit dem sich auch nachhaltige Innovationen fördern ließen.
Zugleich zeigte er die Diskrepanz zwischen den hohen Erwartungen an KI und der tatsächlichen Nutzung in Unternehmen auf: Über die Hälfte der Unternehmen in Deutschland hat sich bisher kaum bis gar nicht mit KI auseinandergesetzt, was über Kurz oder Lang ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnte. Die hierfür verantwortlichen Herausforderungen reichen von fehlenden Ressourcen und rechtlichen Unsicherheiten bis hin zu Ängsten seitens der Mitarbeiter, beispielsweise vor Arbeitsplatzverlust. Doch Strebe betonte auch die Chancen: Mit KI lassen sich Prozesse effizienter gestalten, Ressourcen intelligenter nutzen und Wissen leichter zugänglich machen – etwa durch Wissensmanagement-Tools oder Chatbots. Konkrete Anwendungen, die allgemeine und unternehmensspezifische Anforderungen miteinander verknüpfen, wie der Microsoft Copilot oder der KI-Readiness-Check der GISA, zeigten, dass der Weg zu einer sicheren und produktiven KI-Nutzung bereits vielerorts geebnet wird.
Input 2: „Von Effizienz zu Digitaler Suffizienz“
Anja Höfner vom Leipziger Konzeptwerk Neue Ökonomie lenkte den Blick anschließend auf die ökologischen und sozialen Kosten der Digitalisierung. Sie erläuterte zunächst anschaulich, dass die Herstellung digitaler Geräte eine Vielzahl von (Konflikt)Rohstoffen benötigt und der Betrieb energieintensiver KI-Systeme immense Mengen an Strom und (Kühl)Wasser für die Rechenzentren erfordert. Dies steht in starkem Kontrast zu den Hoffnungen, dass Digitalisierung automatisch zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit führen würde.
Ein zentraler Punkt ihres Vortrags war der sogenannte Rebound-Effekt, der besagt, dass Einsparungen durch Effizienzsteigerungen oft durch neue Verhaltensweisen oder gesteigerten Konsum aufgehoben werden. Sie forderte daher ein Umdenken hin zu „Digitaler Suffizienz“, einem Konzept, das darauf abzielt, digitale Technologien so viel wie nötig, jedoch so wenig wie möglich zu nutzen, und plädierte dementsprechend für eine bewusste, gemeinwohlorientierte Nutzung digitaler Technologien. Praktische Ansätze wie modular aufgebaute Hardware, sparsamer Datenverbrauch und die gezielte Nutzung digitaler Tools könnten darüber hinaus dazu beitragen, die digitale Welt nachhaltiger zu gestalten.
Input 3: „Der digitale Weg zur Nachhaltigkeit – Praktische IoT-Lösungen für mittelständische Unternehmen“
Robert Bogs, Technischer Berater beim Thüringer IT-Unternehmen Alpha-Omega Technology, nahm die Teilnehmenden im Anschluss mit auf eine Reise in die Welt des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT).
Er präsentierte beeindruckende Beispiele, wie Sensorik und smarte Netzwerke mittelständischen Unternehmen helfen können, Ressourcen effizienter zu nutzen oder Emissionen zu reduzieren. So zeigte er etwa, wie Landwirte mit Bodenfeuchtigkeitssensoren den Wasserverbrauch um bis zu 15 % senken können, ohne dabei Einbußen in Qualität oder Produktivität hinnehmen zu müssen. Ein weiteres Beispiel war die Überwachung von Futtersilos in der Landwirtschaft, was dank IoT-Technologie automatisierte Nachbestellungen ermöglicht und so Prozesse optimiert. Auch in kommunalen Projekten kann IoT genutzt werden, um den Alltag der Bewohner nachhaltiger und komfortabler zu gestalten, wie das Beispiel „SMARTinfeld“ (im thüringischen Martinfeld) verdeutlicht.
Input 4: „eID-Roadshow – Jetzt lerne ich Online-Ausweisen“
Rudolf Philipeit vom Verein buergerservice.org brachte abschließend einen praktischen, aber oft unterschätzten Aspekt der Digitalisierung ins Gespräch: Die digitale Identität. Er hob hervor, dass Deutschland mit der Online-Ausweisfunktion des Deutschen Personalausweises zwar über eines der fortschrittlichsten und sichersten Systeme für elektronische Identitäten (eID) verfüge, dieses jedoch nur unzureichend genutzt werde. Die Gründe hierfür sieht er vor allem in der mangelnden Bekanntheit des Systems und seiner Funktionsweise sowie in der fehlenden Vermittlung des Mehrwerts für die Nutzer.
Dabei wird eine sichere digitale Identität – angesichts gestohlener Nutzerdaten, gefälschter Websites, etc. – immer wichtiger. Zudem sei sie der Schlüssel für viele Verwaltungs- und Wirtschaftsanwendungen – von Behördengängen bis hin zu privaten Dienstleistungen, wie Philipeit betonte. Im Zuge der eID-Roadshow demonstrierte er abschließend, wie einfach die Installation und Nutzung der AusweisApp ist.
Fazit: Digitalisierung als Chance für mehr Nachhaltigkeit
Das Netzwerktreffen zeigte eindrucksvoll, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können – wenn sie bewusst und verantwortungsvoll gestaltet werden. Ob durch Künstliche Intelligenz, IoT oder digitale Identitäten: Die vorgestellten Ansätze und Technologien verdeutlichten, wie sie zur Förderung nachhaltiger Praktiken in Unternehmen und Gesellschaft beitragen können – solange sie dem Grundsatz der digitalen Suffizienz folgen.